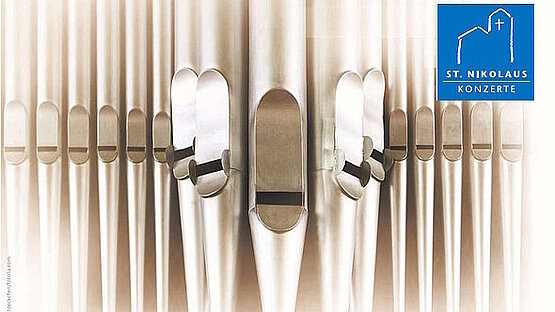Nachdem sich in der jungen Kirche bereits eine Lehrtradition, Liturgie und Ämter entwickelt haben, entstehen etwa zwischen den Jahren 80 und 90 des 1. Jahrhunderts zunächst das Lukas-Evangelium und dann die Apostelgeschichte als Folgewerk des Lukas-Evangeliums. Der Autor, ein gewisser – in beiden Werken aber nicht namentlich erwähnter – Lukas, kannte bereits das Markus-Evangelium und die Logien-Quelle (Q), eine Sammlung von Sprüchen Jesu, und baut auf sie auf. Das etwa zur selben Zeit entstehende Matthäus-Evangelium kennt er nicht. Daraus und aus weiteren schriftlichen Berichten über Jesus und auch mündlich Überliefertem gestaltete er sein Doppelwerk. Er widmet es sowohl am Anfang des Evangeliums als auch am Anfang der Apostelgeschichte dem „verehrten Theophilus“, für den er sorgfältig nachgeforscht und für den er alles der Reihe nach aufgeschrieben hat (Lk 1,1-4; Apg 1,1).
Im Großen und Ganzen hat das Evangelium drei Teile und dazu eine Vor- und eine Nachgeschichte:
| 1,1-4,13 | Vorwort, Vorgeschichte und Vorläufer |
| 4,14-9,50 | I. Jesu Wirken in Galiläa und Judäa |
| 9,51-19,27 | II. Weg nach Jerusalem („Reisebericht“) |
| 19,28-24-12 | II. In Jerusalem: Auseinandersetzung mit den Gegnern, Passion und Auferstehung |
| 24,13-53 | Begegnungen mit dem Auferstandenen |
Was Lukas bietet, ist weniger die Theologie eines verborgenen Fahrplans der Heilsgeschichte als eine Erzählung, in der eine religiöse Gruppe ihre Identität begründet. Für ihn ist wichtig: Diese Gruppe ist das wiederhergestellte Israel. Nur der Selbstausschluss von Juden hat dazu geführt, dass es zur Trennung von Christen und Juden kam. Voll Sympathie schildert er in den Kindheitsgeschichten die Erwartungen jüdischer Frommer, die in Jesus in Erfüllung gehen. Jesus bringt Armen und Kranken Heil (4,18ff). Der Satan flieht und fährt erst am Ende wieder in Judas hinein (4,13; 22,13). ... In die Mitte des Reiseberichts (und seines Evangeliums) stellt er ein Kapitel mit drei Gleichnissen vom Verlorenen – gipfelnd im Gleichnis vom verlorenen Sohn (15,11-32), das das Zentrum seiner Theologie enthält: die Zuwendung Gottes zu allen Menschen, die umkehren. Alle werden – wie der verlorene Sohn – wieder eingesetzt in ihre ursprüngliche Stellung. Die Vorbildlichen werden gefragt, ob sie wie der ältere Bruder diese unverdiente Güte Gottes für weniger Vorbildliche akzeptieren. Dies ist eine „narrative Theologie“ der Sündenvergebung – ohne Sühnetheologie. (Gerd Theißen, Das neue Testament, München 2002, S.77f.)
Lukas stammte wohl aus Antiochia, jenem frühen christlichen Zentrum an der heutigen syrischen Mittelmeerküste. Vielleicht hier oder in einer der anderen großen (römischen) Städte der Mittelmeerwelt entstand das Doppelwerk. Lukas darf als Kosmopolit gelten, denn er hat das ganze römische Reich bereist und er war ab dessen 3. Missionsreise mit dem Apostel Paulus zusammen auch in Jerusalem. Dort kennt er sich aus. In Israels Norden, der Heimat Jesu, allerdings nicht, was sich aus räumlichen Fehlern seines Evangeliums schließen lässt. Von Jerusalem geht bei ihm alles aus („ex oriente lux“). Deshalb beginnt und endet sein Evangelium dort. Die Apostelgeschichte beginnt auch hier, endet aber in Rom, denn jetzt geht es um die Ausbreitung des Lichtes Christi über die ganze (damalig bekannte) Welt.
Der gebildete Lukas müht sich, das Christentum in den gebildeten Kreisen seiner Zeit hoffähig zu machen. Es ist kompatibel mit Rom und nicht in Opposition zur Staatsmacht („Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist ...“). Entsprechend konzipiert er sein Werk. In den 25 Reden der Apostelgeschichte – allein 8 von Petrus und 9 von Paulus – geht die Botschaft zu allen: in der Pfingst-Rede, in der Areopag-Rede, in der Stephanus-Rede. Die Kirche wird zur Weltreligion! Sie mischt sich in die philosophisch-theologische Diskussion ihrer Zeit ein. Sie redet mit – nicht gebückt, sondern selbstbewusst und mit deutlicher Option für ein Miteinander auf Augenhöhe aller gesellschaftlicher Kreise.
Dennoch spielt sich das Pfingstereignis nur innerhalb des Judentums ab. Hier geht es zunächst darum, die unterschiedlichen Strömungen des Judentums und des frühen Christentums zu vereinigen: der Familienkreis um Jakobus, der Jüngerkreis um Petrus und dazwischen verbindend Maria. Lukas führt eingangs der Apostelgeschichte die Gruppen wieder zusammen. Das Johannes-Evangelium wird das später noch ausbauen, genauso wie die Theologie des Geistes.
Markus und Matthäus haben noch mit der Wiederkunft Jesu gerechnet. (Mt: Ich bin bei euch alle Tage.) Lukas aber schreibt: Er ist weg! Er ist nicht mehr da! Das Grab ist leer! – Dafür aber hinterlies er uns seinen Geist. Jesus muß in seiner Himmelfahrt empor fahren, damit der Geist kommen kann. Entsprechend baut er auf die Zeitabfolge des ersten Testamentes: Das Volk Israel ist 40 Tage in der Wüste und bekommt am 50. Tag die Thora. In der späteren Überzeugung jüdischer Theologen waren auch die Völker – vertreten durch das auserwählte Israel - Augen- und Ohrenzeugen des Sinaiereignisses. Die Thora ist eine Gabe für alle! Deshalb gibt es 40 Tage nach der Auferstehung Zeit mit Jesus und am 50. Tag an seiner Stelle den Geist. Der Geist sprengt alle engen Grenzen des Sprechens und Verstehens „bis an die Grenzen der Erde“. Die Pfingstpredigt des Petrus orientiert sich an Joel 3,1-5: Alle werden Prophetinnen und Propheten sein. Jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet – wirklich jeder (alle Nachkommen Abrahams)! Die Zeichen der Gemeinschaft aller bleiben, dass „sie an der Lehre der Apostel festhielten und an der Gemeinschaft; d.h. am Brechen des Brotes und an den Gebeten“. Das Band zum Judentum ist noch nicht zerrissen: „Tag für Tag verharrten sie einmütig im Tempel.“ Auch das Brechen des Brotes in den Häusern entspricht jüdischem Brauch.
Am Ende seines Evangeliums gestaltet Lukas eine große Liturgie (in Emmaus): Wortgottesdienst (24,13-27), Eucharistie (24,28-32) und Entlassung/Sendung (24,33-35). Diese Motive greift er am Anfang der Apostelgeschichte noch einmal auf, vermehrt sie aber um das Motiv der Ergänzung des Zwölferkreises (1,15-26). Darin liegt schon der Aspekt der Hoffnung: Es geht weiter!
Im Geist erfahren die Jünger, dass Jesus mit ihnen auf dem Weg ist: Vor seiner Kreuzigung zunächst im Wort und dann beim Mahl. Nach der Kreuzigung wieder beim Mahl (Emmaus) und in seinem Wort, das sie selbst in die Welt hinaustragen sollen. „Der Weg“ wird das junge Christentum auf einmal genannt. Und wie der Weg zu beschreiten ist, darum ringt die junge Kirche in der Apostelgeschichte. Eine Wende der Richtung, der Botschaft und der Zeit steht an. Die „Mitte der Zeit“ ist nach Lukas nicht die Zeit Jesu allein, sondern auch noch die erste Apostelgeschichten-Zeit bis zum „Apostelkonzil“. Davor ist die Zeit des alten Bundes, danach die Zeit der Kirche in der Welt. Bis dahin verwendet die Apostelgeschichte ein Septuaginta-Griechisch, ab dann ein gebildetes Koiné-Griechisch.
Entsprechend kann die Apostelgeschichte wie folgt gegliedert werden:
| 1,4-8,3 | 1. Die Kirche in Jerusalem |
| 8,4-12,23 | 2. Die Kirche in Judäa und Samaria |
| 13,4-14,28 | 3. Die erste Missionsreise des Paulus |
| 15,1-35 | 4. Das Apostelkonzil in Jerusalem |
| 15,36-18,22 | 5. Die zweite Missionsreise des Paulus |
| 18,23-21,17 | 6. Die dritte Missionsreise des Paulus |
| 21,18-28,13 | 7. Verhaftung und Gefangenschaftsreise nach Rom |
In dieser Grobgliederung hat der vierte Teil eindeutig den mittleren Rang. Vom Apostelkonzil entfaltet sich die junge Geschichte der Kirche nach vorne und rückwärts und lässt ihren inneren Sinn erkennen.
Bei allem Bemühen, Rom nicht gegen das junge Christentum aufzubringen, kennt das Doppelwerk doch einen beißenden Spott gegen die Großen dieser Welt. Die religiösen Führer haben Angst vor Petrus (und seiner Botschaft). Gott ist mit den Kleinen, Armen und Schwachen zuerst (Marias Magnificat) und überhaupt auch mit den Frauen. Vergleichbar einer Frauen-Quote kommen zu den Männer- immer auch entsprechende Frauen-Geschichten: Zacharias und Maria, Simeon und Hanna, der verlorene Sohn und die verlorene Drachme, bis hin zu den wichtigen Frauen Priszilla, Phöbe und Junia am Ende der Apostelgeschichte.
Alexander Brückmann